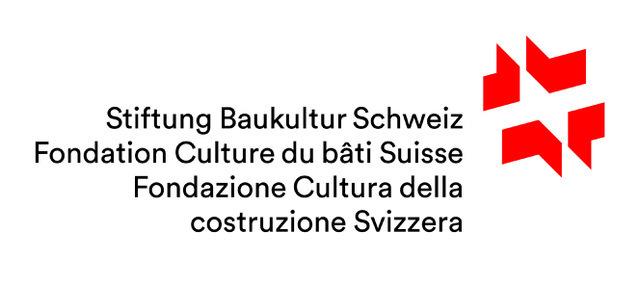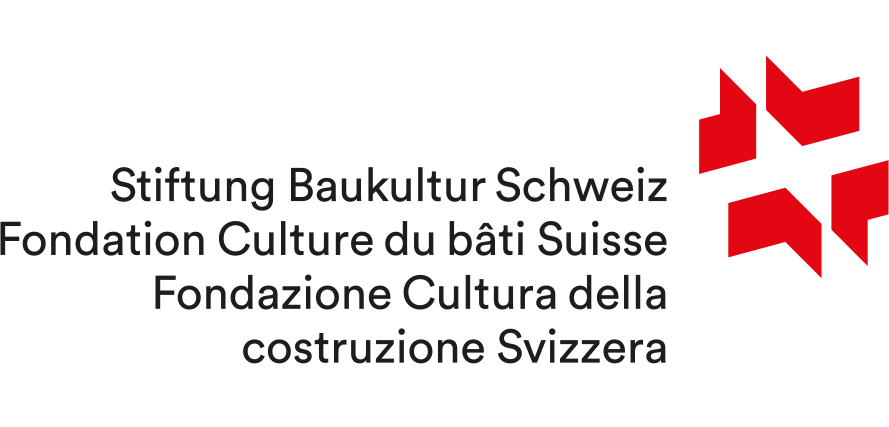«Baukulturelles Get Together» vom August 2025 © Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert
10 ottobre 2025
Stiftung Baukultur Schweiz | Da un punto di vista personale
Was Baukultur zur Rendite beiträgt
Das diesjährige «Baukulturelle Get Together» befasste sich mit dem Spannungsfeld zwischen Baukultur und Rendite und legte damit die Diskussionsbausteine für die anstehende Tagung am 12. November. Im Rahmen eines interdisziplinären Austauschs in Gruppen wurden unterschiedliche Perspektiven aus Architektur, Wirtschaft, Politik und Forschung miteinander ins Gespräch gebracht. Gemeinsam suchten sie nach neuen Perspektiven auf die wirtschaftliche, ökologische und soziale Dimension der Rendite.

Enrico Slongo, Präsident der Stiftung Baukultur Schweiz, heisst die Anwesenden willkommen. © Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert

Roland Füss, Professor für Immobilienfinanzierung an der HSG, führt die Anwesenden in die Gruppenarbeit ein. © Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert
Schon in seiner Einführung machte Roland Füss, Professor für Immobilienfinanzierung an der Universität St.Gallen und Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizerischen Instituts für Banken und Finanzen (s/bf-HSG), deutlich, dass Rendite mehr bedeutet als rein finanzielle Erträge. Wirtschaftliche Rendite sei nur eine von mehreren Möglichkeiten, Baukultur und Rendite miteinander zu denken. Vielmehr gilt es, Rendite auch als gesellschaftliche Dimension zu verstehen. Teil dieser Ebene von Rendite sind sowohl der ökologische Impact als auch die soziale Wertschöpfung.
Nach der Einführung verteilten sich die in verschiedenen Sparten des Bauwesens tätigen Teilnehmenden an sechs Tischen im Garten der Geschäftsstelle der Stiftung, um diese unterschiedlichen Dimensionen der Rendite in Bezug auf Baukultur gemeinsam zu diskutieren. Die Zusammensetzung war bewusst interdisziplinär gewählt, um den Dialog zwischen verschiedenen beruflichen Perspektiven zu fördern. Vertreten waren unter anderem Berufsverbände, private wie öffentliche Bauherrschaften, baukulturelle Organisationen, politische Personen aus Bund, Kantonen und Gemeinden, Fachpersonen aus Architektur, Landschaftsarchitektur, Bauwirtschaft und Immobilien sowie Forschende.

Die Teilnehmenden diskutierten an sechs Tischen zu den drei Themenfelder. © Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert

Die Diskussionen erfolgten in interdisziplinären Gruppen. © Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert
Im ersten Themenbereich zur Baukultur und wirtschaftlichen Rendite konzentrierten sich die Teilnehmenden darauf, was hohe Baukultur für den Immobilienwert langfristig wie kurzfristig bedeutet. Wo bestehen mögliche Zielkonflikte und Finanzierungsbarrieren? Und welche Modelle könnten helfen, Baukultur wirtschaftlich tragfähig zu machen? Die Diskutierenden formulierten unter anderem die These, dass die Kriterien für hohe Baukultur nicht zwangsläufig höhere Kosten verursachen, sofern sie von Anfang an richtig eingebunden werden. Mehr noch, hohe Baukultur könne in bestimmten Situationen selbst zum wirtschaftlichen Treiber werden. Zugleich wurde betont, dass Baukultur sich nur schwer quantifizieren lässt. Sie ist weniger Kennzahl als Haltung; weniger Ergebnis als Prozess.
Auch im Themenbereich zum ökologischen Impact der Baukultur stand die Verbindung zu den acht Kriterien für hohe Baukultur im Zentrum. Inwiefern führt das Berücksichtigen dieser Kriterien zu ökologischer Nachhaltigkeit, und wo liegen mögliche Zielkonflikte? Besonders im Fokus standen resiliente Strukturen, verantwortungsvolle Bodennutzung, Innenverdichtung und Biodiversität. Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass die Lebenszykluskosten stärker in den Vordergrund rücken sollten als die reinen Investitionskosten, da letztere bei ökologischer Bauweise oft höher liegen. Als förderlich wurden regulatorische Massnahmen, Anreizsysteme, Rechtssicherheit und qualitätssichernde Verfahren genannt. Mehrere Stimmen betonten zudem die Bedeutung eines gesamtheitlichen Denkens, das auch Perspektiven wie jene der Landschaftsarchitektur miteinbezieht.

Roland Füss beim Erläutern der von ihm formulierten Fragen. © Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert

Präsentation der Ergebnisse im Plenum. © Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert
Die Gruppen des dritten Themenbereichs widmeten sich dem Verhältnis von Baukultur und sozialer Wertschöpfung. Dabei stand die Frage im Raum, welche räumlichen, soziologischen und ökonomischen Transformationsprozesse auf den sozialen Wert der gebauten Umwelt einwirken und welche Rolle die Baukultur bei der Schaffung von Zugehörigkeit, Identifikation und sozialen Beziehungen spielt. Ausgangspunkt der Gespräche war hier die Frage, was soziale Wertschöpfung überhaupt bedeutet. Ob Durchmischung, Integration, Partizipation, Identifikation, Begegnungsmöglichkeiten, bezahlbarer Wohnraum, Sicherheitsgefühl, Aneignung oder Nutzungsflexibilität: Die soziale Wertschöpfung müsse für jede Bauaufgabe zunächst definiert werden. Dies erfordere auch eine soziale Ambition, die auf die Bildung von Gemeinschaft ausgerichtet ist.
Begleitet wurden alle diese Debatten immer wieder von der Frage der Messbarkeit, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Das Tagungsthema stellt mit dem Wort «Rendite» die Frage der Quantifizierbarkeit bewusst in den Raum. Da die hohe Baukultur im Sinne des vom Bund vorgeschlagenen Davoser Systems auf Qualitätskriterien aufbaut, ergibt sich hier ein besonderes Spannungsfeld. Diese Debatte wird an der Tagung am 12. November in St. Gallen weitergeführt. Internationale Referent:innen werden dort ihre Forschungen vorstellen, bevor drei thematische Podien die wirtschaftliche Rendite, den ökologischen Impact und die soziale Wertschöpfung vertieft behandeln. Jetzt zur Tagung anmelden
Die Diskussionen am «Baukulturellen Get Together» setzten sich beim anschliessenden Apéro fort. Die entspannte Atmosphäre im Garten und das warme Wetter trugen dazu bei, dass bis spät abends weiter über Baukultur, ihre Chancen und Herausforderungen gesprochen wurde.

© Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert

© Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert

© Stiftung Baukultur Schweiz - Fotograf: Conrad von Schubert
Caroline Tanner
Caroline Tanner ist Architektin, Autorin und Philosophin. Sie studierte Architektur an der ETH Zürich und arbeitete mehrere Jahre als Architekturjournalistin bei den NZZ Fachmedien. 2024 hat sie den «Master in Geschichte und Philosophie des Wissens» mit einer Arbeit in Architekturphilosophie mit der Bestnote abgeschlossen.

Stiftung Baukultur Schweiz
Die Stiftung Baukultur Schweiz ist eine nationale, neutrale und politisch unabhängige Stiftung. Im Frühjahr 2020 gegründet, bringt sie Akteure zusammen, schafft Plattformen, initiiert Prozesse und macht sich stark für jene, welche die Grundlagen der Baukultur inhaltlich ausarbeiten oder diese in der Praxis umsetzen.